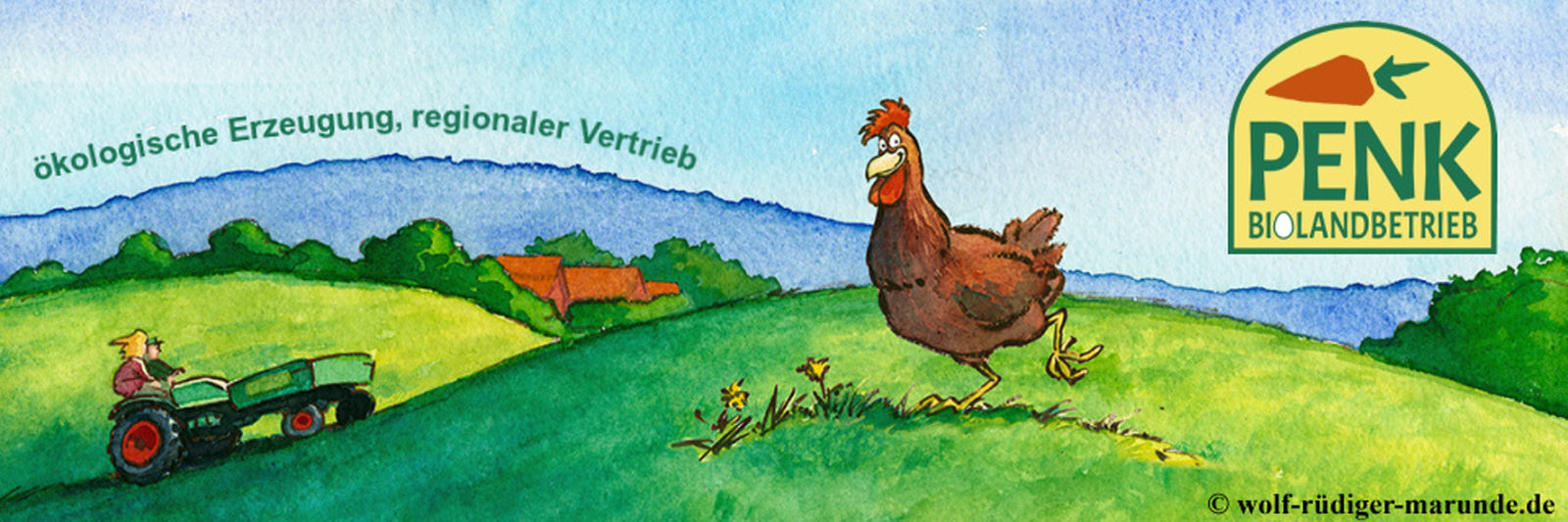Nachhaltigkeit
Charakterisierung unseres Betriebes und Gedanken zur Nachhaltigkeit
Die Betriebsflächen, die wir im Jahr 2002 von unserem Verpächter übernahmen und nun bewirtschaften, werden bereits seit 1985 ökologisch und nach Biolandrichtlinien bewirtschaftet. Dazu kauften wir unsere kleine Hofstelle im Dorf, die damals allerdings nur noch als Wohnhaus genutzt wurde, heute jedoch wieder voll als landwirtschaftlicher Betrieb existiert.
Der Betrieb wurde in den ersten Jahren als extensiver Nebenerwerbsbetrieb mit einer dreigliedrigen Fruchtfolge, bestehend aus Kleegras, Weizen und Dinkel, weitergeführt.
Zunächst begannen wir den Betrieb weiterzuentwickeln, indem wir mit dem Kartoffelanbau begannen und in den folgenden Jahren auch den Gemüseanbau und die Legehennenhaltung etablierten, die zunächst in einem ehemaligen Kuhstall begann. Allerdings war die Tiergesundheit, trotz Einhaltung der Biolandrichtlinien überhaupt nicht zufriedenstellend. Es gab viele Fälle von Feder picken, auch war die Situation im stallnahen Auslauf nicht vorzeigbar, so dass wir uns entschlossen, lieber mit der Hühnerhaltung aufzuhören, oder in ein modernes und artgerechtes Haltungssystem zu investieren. Die Lösung für eine vorzeigbare und artgerechte Hühnerhaltung fand sich nach reiflicher Überlegung im mobilen Stallsystem der Firma Weiland. Nach längerer Konzeptionszeit (ca. 1 Jahr) kauften wir den Prototypen des heutigen 800er Hühnermobils der Firma Weiland und hatten damit dann auch endlich die innerbetriebliche Kleegrasnutzung gelöst und eine innerbetriebliche Bereitstellung von hochwertigem Dünger in Form von Hühnermist sicher gestellt. Im Laufe der folgenden drei Jahre weiteten wir die Legehennenhaltung durch den Kauf weiterer Hühnermobile aus, um die Nachfrage in den Märkten und bei der Gastronomie decken zu können.
Ökologische Nachhaltigkeit
Für uns war es immer alternativlos, den Betrieb ökologisch zu bewirtschaften, da bei dieser Bewirtschaftungsform der größtmögliche ökologische Nutzen zu erwarten war: Die Erzeugung unbelasteter Lebensmittel bei gleichzeitig hohem Nutzen für die Biodiversität.
Diese Einschätzung konnte im Laufe der Jahre durch die Teilnahme an der ergebnisorientierten Honorierung auf Ackerland (Studie des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie (NLÖ, heute NLWKN)) durchaus bestätigt werden, denn obwohl wir mittelmäßig zufriedenstellende Weizenerträge von 40 dz/ha erzielen konnten, hat das NLÖ im Rahmen des Programmmonitorings bis zu 19 verschiedene Arten auf unseren Feldern gefunden.
Für uns ist der Kleegrasanbau immer ein wichtiges Element unserer Fruchtfolge gewesen, da er zentral im Bezug auf die Nährstoffversorgung der Fruchtfolge und auf die Bekämpfung der Wurzelunkräuter ist. Durch die Ausweitung des Kartoffelanbaus hin zu einem Viertel der Fruchtfolge stellte sich uns bald die Frage nach der Humusbilanz. Zwar hatten wir einjähriges Kleegras und bekamen etwas Rindermist in den Betrieb, zwar bauten wir partiell Zwischenfrüchte an, aber durch die teilweise Abfuhr des Strohs und der Ausweitung der Hackfrüchte fiel die Humusbilanz trotzdem negativ aus.
Die Getreideerträge waren mit ca. 40 dt/ha im Schnitt bei Weizen und Dinkel aus unserer Sicht langfristig zu niedrig, wenn man bedenkt, dass wir hier auf 80 Bodenpunkten wirtschaften. Somit reifte die Entscheidung, die Fruchtfolge auf eine 5-gliedrige umzustellen und das Kleegras zwei Jahre stehen zu lassen.
Folgende Effekte sollten hiermit erreicht werden und wurden auch erreicht:
1. Positive Humusbilanz
2. Bessere Unterdrückung der Wurzelunkräuter
3. Größere symbiontische N-Fixierung, damit höhere Getreideerträge und bessere Qualitäten (jetzt im Schnitt 60 dt/ha)
4. Winterweide für die Hühner
Durch die Etablierung der Legehennenhaltung konnte somit das Kleegras innerbetrieblich verwertet werden und es fällt so viel hochwertiger Dünger an, dass wir zwei Fruchtfolgeglieder pro Jahr zart bestreuen können.
Hierdurch können wir seit 2015 auf den Einsatz von Zukaufsdüngern wie Haarmehlpellets komplett verzichten. Der Nährstoffkreislauf schließt sich somit weiter, auch wenn natürlich noch Futter für die Legehennen importiert wird. Für eine positive ökologische Nachhaltigkeit auf unserem Betrieb spricht auch, dass sich die Nährstoffbilanzen nur im schwach positiven Bereich bewegen. Wären sie negativ, wäre die Produktion langfristig nicht ökologisch nachhaltig (Humusabbau). Wären die Salden zu hoch (aus unserer Sicht >40 kg N/ha) wäre der teure Stickstoff sinnlos ins Grundwasser verlagert worden. Irgendwo dazwischen bewegt sich aus unserer Sicht das ökologische Optimum. Mit dem jetzigen Betriebskonzept
kommen wir dieser Idealvorstellung sehr nahe.
Dass diese Überlegungen in die richtige Richtung gingen, zeigt sich auch an der Entwicklung der Humusgehalte unserer Böden. Diese lagen bei Betriebsgründung 2002 bei 2,13% und liegen nun, 20 Jahre später, bei 2,48%.
Das hört sich zunächst nicht dramatisch an. Es ist aber bekannt, dass Humusaufbau ein extrem langwieriger und in der Fläche schwer umzusetzender Prozess ist. Wohingegen Humusabbau sehr viel schneller vonstatten geht, ein wirkliches
Problem vieler falscher Landnutzungsformen. Dem Humusaufbau kommt gerade auch im Hinblick auf die Reduktion der Treibhausgase eine entscheidende Rolle zu.
In unserem Anbauverband Bioland gelten seit 2021 die sogenannten Biodiversitätsrichtlinien, der einzige Verband, der sich selbst solch hohe Anforderungen stellt. Der Beitrag zum Erhalt und der Verbesserung der betrieblichen Biodiversitätsleistungen soll messbar sein. Dafür wurden entsprechende Regeln entwickelt, die beim jährlichen Betriebsaudit kontrolliert werden. Nach einem speziellen System muss der Betrieb 100 Biodiversitätspunkte erreichen. Schafft er das nicht, verstößt er gegen die Biolandrichtlinien und muss sich mit Beratungshilfe verbessern. Wir erreichen auf unserem Betrieb regelmäßig Punktzahlen zwischen 200 und 300!
Wir wollen uns auf dem Erreichten nicht ausruhen, sondern sind ständig bestrebt, weitere Verbesserungen zum Erhalt der Artenvielfalt auf den Feldern und an unserem Betriebsgelände zu erreichen.
Ökonomische Nachhaltigkeit
Natürlich ist es eines der wesentlichen Anliegen, den Betrieb ökonomisch auf stabile Füße zu stellen. Nur wie kann bei einer so geringen Betriebsgröße ein ausreichendes Familieneinkommen erwirtschaftet werden?
Folgende Überlegungen hatten wir:
1. Mit Ökoprodukten, da hier der Markt weiter wächst
2. Durch Direktvermarktung
3. Durch die Erzeugung nachgefragter Produkte
4. Durch geschicktes Marketing
5. Durch fortwährendes Infragestellen der betrieb lichen Ausrichtung
Durch eine starke Diversifizierung in der Vermarktung machen wir uns von einzelnen Marktpartnern relativ unabhängig. Es wird nie der Markt in allen Segmenten gleichzeitig zusammenbrechen.
Folgende Segmente haben wir belegt:
1. Ab-Hof-Verkauf mit Selbstbedienung
2. Belieferung etlicher Supermärkte im Umkreis von 20 km (REWE, Edeka, Alanatura),
3. Belieferung von (hochpreisigen) Restaurants
Ein besonderes Modell haben wir uns im Zusammenhang mit dem Kauf des ersten Hühnermobils ausgedacht: Wir wollten uns das Geld nicht ausschließlich bei einer Bank leihen, sondern wollten durch Einbindung potentieller größerer Abnehmer aus dem Lebensmitteleinzelhandel und der Gastronomie eine größtmögliche Identifikation der Partner mit unseren Produkten erzielen. Die angesprochenen drei Kooperationspartner (Hardenberg Burg hotel, REWE Markt Gippert, E-NEUKAUF Rose) haben uns insgesamt 30 % des benötigten Geldes für den Kauf des großen Stalls geliehen. Dieses Geld wurde von uns über die Lieferung unserer Produkte innerhalb eines Jahres zurückgezahlt. Der Vorteil für die Partner war die Sicherung eines regionalen und verlässlichen Lieferanten mit hochwertigen Produkten und bevorzugter Belieferung. Der Vorteil für uns als Betrieb war die unbürokratische Kreditbereitstellung und die Sicherung und Planbarkeit des Absatzes der Produkte. Eine wirkliche win-win-Situation.
Dieses Modell wurde erfolgreich umgesetzt und strahlt noch lange nach, was sich in fairem und vertrauensvollem gegenseitigen Geschäftsverhalten bis jetzt widerspiegelt.

Soziale Nachhaltigkeit
Landwirtschaft ist von jeher ein idealer Bereich, um Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten einzubinden. Durch den Gemüse- und Kartoffelanbau, die Legehennen- und Hähnchenhaltung in Mobilställen sowie Freiland-Schweinehaltung fallen viele Arbeiten an, in die schwächere Menschen sinnvoll eingebunden werden können.
Da wir seit einigen Jahren auch in Schlechtwetterperioden Innenarbeiten anbieten können, haben wir 2013 beschlossen, den Harz-Weser-Werkstätten, die ständig auf der Suche nach Außenarbeitsplätzen sind, eine Zusammenarbeit anzubieten. Es kommen nun regelmäßig zwei Männer zu uns auf den Hof und helfen bei allen anfallenden Arbeiten. Mit dieser Kooperation sind alle Beteiligten sehr zufrieden.
Um mit unserem Hof noch weitere soziale Aspekte zu verbinden, verkaufen wir seit 2015 unsere Eier in selbst gestalteten Eierpappen. Für die Herstellung der Pappen haben wir zwei Behindertenwerkstätten der Region eingebunden. Die
Göttinger Werkstätten übernehmen den Druck und die Stanzung der Etiketten, während die Harz-Weser-Werkstätten diese auf die Pappenrohlinge kleben. Auf der Pappe wird der Kunde über die Kooperation informiert. Somit unterstützt
ein Kunde mit dem Kauf unserer Eier nicht nur den Ökolandbau und die artgerechte Tierhaltung, sondern auch die Behindertenwerkstätten der Region.
Regelmäßig nehmen wir auch Praktikanten und Auszubildende im 1. Lehrjahr zu uns auf den Hof.
Besuchergruppen aus dem In- und Ausland kommen zu uns, um sich über unsere Form der Tierhaltung und Vermarktung sowie das Betriebskonzept zu informieren. Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Universitäten Göttingen und Witzenhausen, die regelmäßig Exkursionen zu unserem Betrieb unternehmen oder Forschungsarbeiten bei uns durchführen. Dabei geht es z. B. um Tierwohl, Forschung zu Insekten, Artenvielfalt bei Wildpflanzen oder Bodenbeprobungen.
Für unser Engagement im sozialen Bereich wurden wir 2018 von Bioland Niedersachsen mit dem „Grünen Herz“ aus gezeichnet.